4. Die große Familie der elektromagnetischen Wellen
Für die Nachrichtenübertragung wird heute ein weiter Bereich
von elektromagnetischen Wellen verwendet. Gemessen nach ihren Frequenzen
umfasst dies einen Bereich von ca. 10 Kilohertz bis einige Gigahertz.
Da sich die Welle während einer Schwingung mit Lichtgeschwindigkeit
fortbewegt, errechnet man daraus die Länge einer Schwingung im Raum,
d. h. die Wellenlänge. Der entsprechende Bereich reicht von 30 km
bis 30 cm. Wenn auch alle diese Wellen nichts anderes darstellen als die
pulsierende Verkettung von elektrischen und magnetischen Feldern, so sieht
man doch Unterschiede in der Art, wie sie sich entlang der Erdoberfläche
und durch die Atmosphäre ausbreiten. Während Langwellen
auch um die Krümmung der Erde gelangen können und demnach eine
große Reichweite haben, breiten sich Kurzwellen mehr geradlinig
und eher nur in Sichtweite aus. Das ist ein Grund, warum man für
den Mobilfunk im Gigahertzbereich so kurze Abstände für die
Sendeantennen braucht.
Jenseits der oberen Grenzen der Funkfrequenzen setzt sich nun aber der
Bereich der elektromagnetischen Wellen kontinuierlich fort mit immer höheren
Frequenzen und immer kürzeren Wellenlängen. Das Diagramm in
Bild 3 zeigt in einer langen Skala den Gesamtbereich der elektromagnetischen
Wellen, in dem die Funkwellen nur einen kleinen Bereich bilden: bei den
niedrigeren Frequenzen auf der rechten Diagrammseite. Wir erkennen ihre
Zugehörigkeit zu einer großen Familie natürlicher Wellenstrahlung,
die den ganzen Kosmos erfüllen: vom sichtbaren Licht (blau-grün-rot),
über die Röntgen- bis zu den kosmischen Strahlen. Obwohl
sie alle gleichermaßen aus pulsierenden elektrischen und magnetischen
Feldern bestehen, zeigen sie aber doch mit immer kürzerer Wellenlänge
eine zunehmende Wechselwirkung mit Mensch und Natur. Dies beginnt gleich
links nach dem sichtbaren Licht mit der Ultraviolett-Strahlung.
Auf der niederfrequenteren Seite, also rechts vom Licht, hat man bislang
nur harmlosere Effekte gefunden, wie z. B. eine Materialerwärmung
bei Absorption von Mikrowellen mit hoher Intensität.
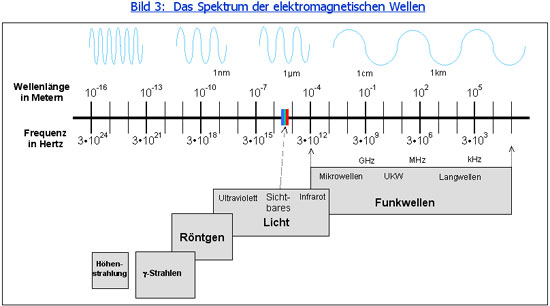
Für die Bilder danken wir Herrn Prof. Claus von der Universität München
<< zurück --- weiter >>